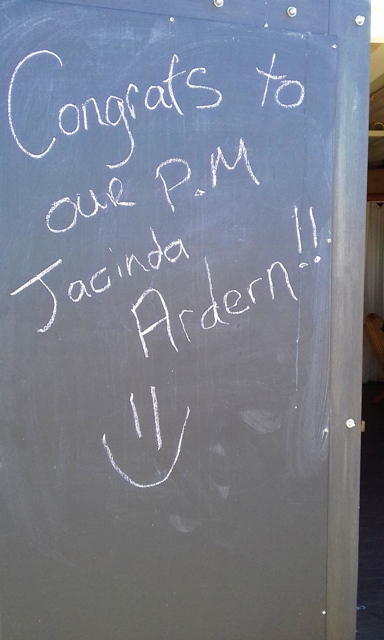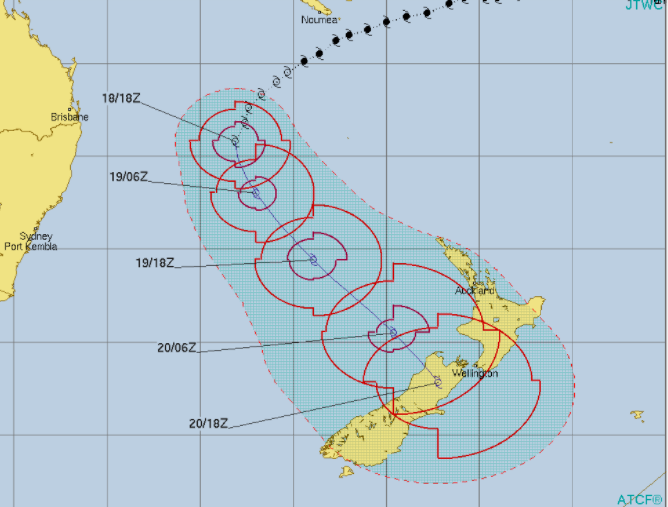16. – 23. Januar 2018

Frühmorgens passieren wir Cape Palliser und erreichen damit offiziell die berühmt-berüchtigte Cook Strait. Aufgeregt sind wir schon ein bisschen, aber das Wetter spielt mit, die See ist ruhig und nach zwei Mal rechts abbiegen sehen wir schon die Skyline von Wellington.
Wellington liegt gut geschützt in einer Bucht, ein Teil des Ufers wird Oriental Bay genannt und ist ein Strand: eine Hauptstadt mit Sandstrand! An einem sonnigen Tag wie diesem mitten in den Sommerferien geht es lebhaft und laut zu. Familien sitzen im Sand, Kinder hüpfen ins Wasser oder holen sich ein Eis in einem der vielen Cafés an der Uferstraße. Kein Wunder, dass es hier so entspannt zugeht. Im Prinzip könnte man einfach mal in der Mittagspause baden gehen… Auch soll sich von Wellington aus die wunderbare Kaffee-Kultur in Neuseeland ausgebreitet haben. Wir fühlen uns sofortwohl in dieser Stadt.

Das Stadtzentrum ist nicht groß, alles ist fußläufig zu erreichen, wenn man die Uferpromenade entlang geht, die sich vom Sandstrand aus bis zum anderen Ende der Bucht mit dem Industriehafen erstreckt, kommt man erst an einem kleinen Hafen für Segelboote vorbei, dann stehen da ein paar Museen, Restaurants und Cafés mit Meeresblick. Parallel dazu verläuft die Einkaufsmeile, die sich durch das Zentrum schlängelt und dazwischen befindet sich das großzügig angelegte Civic Center, mit der Stadtbibliothek und der städtischer Galerie und über allem, oben am Berg liegt der Botanische Garten.

Die Architektur der Stadt ist die reinste Stilmischung: hübsche kleine Holzhäuser im viktorianischen Stil, die fast wie Puppenhäuser wirken, mit kleinen Vorgärten voller Blumen, in der Innenstadt dagegen stehen viele große Bauten im Art Decó Stil der Zwischenkriegszeit, als es Wellington wirtschaftlich gut ging, Banken, Versicherungen, Behörden wurden darin untergebracht, und viel später erst kamen die Hochhäuser hinzu, die seit den 1990er Jahren gebaut wurden.



Jetzt im Sommer ist viel los in der Stadt: zwei Wochen lang findet jeden Abend ein Konzert im Botanischen Garten statt, eine Lichtshow gibt es dazu, Bäume und Sträucher werden bunt und abwechslungsreich angestrahlt. Mit dem Cable-Car kann man von der Hauptstraße hoch zum Botanischen Garten fahren, zum Space Place, Museum und Planetarium in einem. Am Wochenende feiern sich die Einwanderer und Gastarbeiter der pazifischen Südseeinseln Tonga, Samoa, Fidschi uvm. mit einem eigenen Festival, dem Pasifiska. Eine große Musikbühne ist aufgebaut, dazu Essenstände, Sportwettbewerbe finden statt, überall beste Stimmung.

Das Te Papa Museum wirbt damit, Neuseelands größtes und bedeutendstes Museum zu sein: in einem Neubau mit sechs Stockwerken zeigt es die Geschichte und Natur Neuseelands und viel Kunst und Kunsthandwerk. Der größte Riesentintenfisch, der jemals aus dem Meer gefischt wurde, ist zu bewundern (10m lang und 495kg schwer war er), ebenso wie eine schöne Ausstellung über die Geschichte und Kunst der Maori aus der Gegend.
Ein paar hundert Meter weiter ist das viel kleinere Stadtmuseum, das die Geschichte Wellingtons chronologisch einprägsam präsentiert: Te Upoko o te Ika a Maui – Der Kopf von Mauis Fisch, so bezeichneten die Maori diese Bucht, als sie um 925 n. Chr. das erste Mal hier landeten. Später wurde eine Siedlung gegründet, Te Whanganui-a-Tara – der große Hafen von Tara, und das ist auch heute noch der Name Wellingtons in der Maori Sprache. Verschiedene Stämme lebten in diesem Gebiet in den folgenden Jahrhunderten, mal schlossen sie sich zusammen, dann wieder bekämpften sie sich, bis sie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ihr Land verloren und den europäischen Siedlern weichen mussten.
Die New Zealand Company brachte 1840 das erste Schiff mit Einwanderern hierher und gründete den Ort Wellington, nach dem ersten Duke of Wellington benannt. Schon 25 Jahre später, 1865 wurde die Hauptstadt von Auckland nach Wellington verlegt. Sie sollte geographisch in der Mitte liegen und die beiden Inseln miteinander verbinden, war das Argument damals wie heute.
Neuseeland gehört noch zum Commonwealth und nennt Queen Elisabeth II. ihr Oberhaupt, ist ansonsten aber ein eigenständiger Staat. Der Parlamentsbetrieb selber ist noch in vielen seiner Regeln an das Britische Unterhaus angelehnt, auch der Plenarsaal sieht dem britischen Vorbild sehr ähnlich, mit einem Unterschied, dass der „Speaker“ hier in Neuseeland seinen Sitz und Rückenlehne mit einem hellen Schaf-Fell ausgepolstert hat; und dass schon vor geraumer Zeit das Oberhaus abgeschafft wurde. Dafür wird in Neuseeland inzwischen genauso wie in Deutschland gewählt, mit Erst- und Zweitstimme, Verhältniswahlrecht, Überhangmandaten und 5%-Hürde.
Letzten Oktober gab es Wahlen, am gleichen Wochenende wie in Deutschland, die Regierung wurde sehr schnell gebildet, eine Koalition aus Labour, New Zealand First und Grünen. Just in der Woche, als wir in Wellington waren, erklärte die junge dynamische Premierministerin, dass sie schwanger sei und im Juli ihr Baby zur Welt kommen soll!
Alle freuten sich mit ihr!
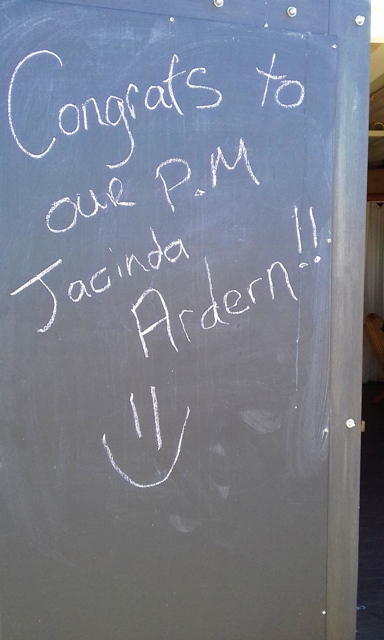
Das Parlamentsgebäude mit Plenarsaal und Sitzungsräumen ist durch und durch viktorianisch und auch nach zwei Bränden genauso wieder aufgebaut worden, allerdings inzwischen auf ein erdbebensicheres Fundament gestellt worden. Im Eingangsfoyer steht die Büste von Kate Sheppard, die sich für das Frauenwahlrecht eingesetzt hatte, das 1893 eingeführt wurde. Neuseeland ist heute sehr stolz darauf, dass es das erste Land der Welt war, in dem Frauen ungehindert zur Wahl gehen konnten. Links neben dem Parlamentsgebäude wurde in den 80er Jahren ein runder Betonklotz gebaut, „Beehive“, Bienenkorb genannt: das Abgeordnetenhaus. Auf der anderen Seite befindet sich in einem eigenen Gebäude die Parlamentsbibliothek, auch sie schön, alt und ehrwürdig.

Parlamentsgebäude, alt und neu

Parlamentsbibliothek
Woher ich das alles weiß? Es werden täglich Touren durch das Parlament angeboten, die sehr informativ und unterhaltsam sind. Unsere Führerin liebte definitiv ihren Job und hätte uns sicher noch eine weitere Stunde mit interessanten Geschichten fesseln können.
Auckland, die Millionenstadt, ist unbestritten das wirtschaftliche Zentrum des Landes, Wellington punktet dagegen mit seinem gemütlichen Flair, mit Kunst, Kultur und Lebensfreude. Und mit vielen sehr freundlichen Menschen! Sieben Tage hatten wir Zeit, und haben die Stadt sehr ins Herz geschlossen!