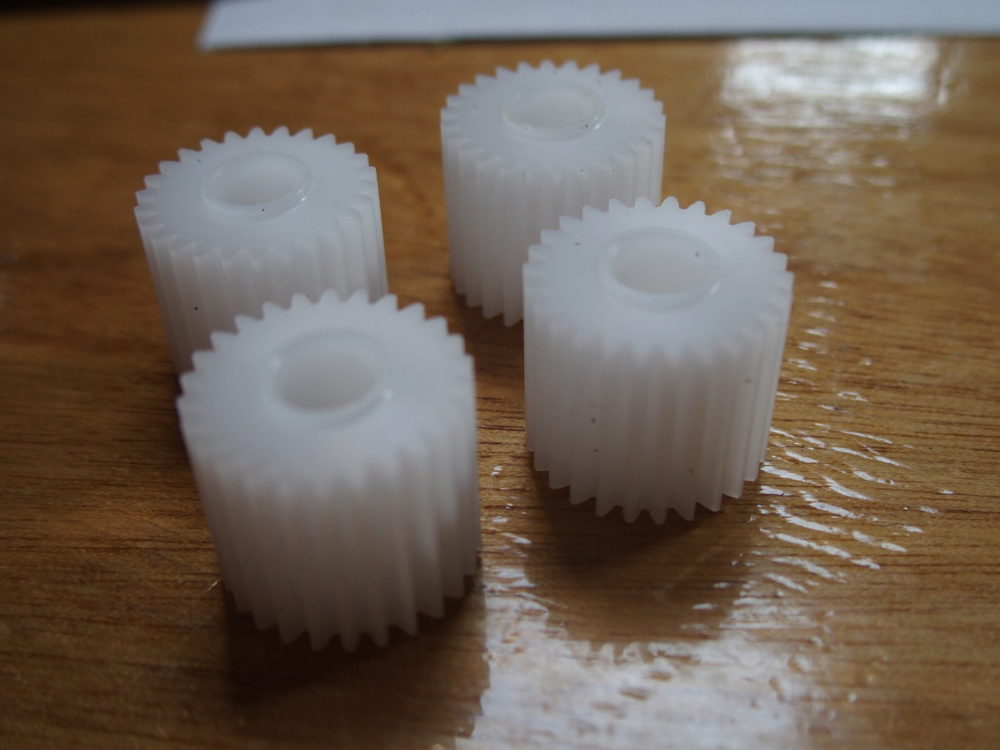Im Internet studieren wir lange die Bus-Pläne, was gar nicht so einfach ist mit den japanischen Webseiten. Morgens stehen wir an der Haltestelle, gespannt darauf, ob das auch alles so klappt mit unserem Ausflug nach Naha. Eine ältere Dame stellt sich dazu, studiert den Fahrplan und wendet sich wortreich an uns, bevor sie weiter geht. Wir erwidern ihr Lächeln, können ihr aber nicht antworten, denn wir haben kein einziges Wort verstanden. Meinte sie etwa, der Bus käme nicht?
Der aber kommt pünktlich und wir fahren los. Wo Yonabaru aufhört und wo ein anderer Ort anfängt, ist überhaupt nicht zu erkennen, die Ortschaften gehen ineinander über. 80% der Bevölkerung von Okinawa wohnt hier im Süden der Insel, im Ballungszentrum um Naha herum. Wir sehen viele zweckmäßige Wohnhäuser, Einkaufszentren, Autohäuser, Betriebe, alles neu und nach den Zerstörungen der letzten Kriegsmonate nach und nach aufgebaut.
Am zentralen Busbahnhof in Naha steigen wir aus und finden schon nach wenigen Schritten ein nach außen hin unscheinbares aber im Inneren äußerst luxuriösen Kaufhauses im Stil der Galerie Lafayette. In einer der oberen Etagen bei der Haushaltsabteilung bewundern wir die schöne Alltagskeramik und das Regal mit den Stäbchen. Und passend dazu, befindet sich auf dieser Etage auch eine Abteilung mit Ständen, an denen allerlei Köstlichkeiten angeboten werden: im Waffeleisen gebackene salzige und süße Teilchen, mit Ingwer eingelegte kleine Venusmuscheln, Algen aller Art, ein in Fässern über Jahre gereifter Pflaumenessig, der ähnlich wie ein guter alter Balsamico schmeckt und ein Vermögen kostet. Überall an allen Ständen darf man probieren, was wir, genauso wie die japanische Kundschaft, ausgiebig tun – und wir sind hin und weg von den vielen so unterschiedlichen Geschmackrichtungen!



Muji-Produkte!
Aber eigentlich wollten wir zur Kokusai-dori, dem touristischen Zentrum der Stadt, einer 1,6 km langen Straße mit Läden und Restaurants, im Wesentlichen für die 6,5 Mio Touristen gedacht, die jährlich nach Okinawa kommen. Hier kann man sich mit allen möglichen Mitbringseln eindecken, die für Okinawa typisch sind, Bittergurken als Saft oder getrocknet, schwere dunkle Keramikgefäße oder bunte Gläser, die Hunde mit Löwenkopf in allen Größen und Farben und sommerlich-bunte Hemden und Kleider. Schon nach ein paar hundert Metern sind wir völlig überfordert von dem Trubel und den vielen Läden mit ihrem fast identischen Angebot.



Plötzlich bleibe ich überrascht stehen und traue meinen Augen nicht: siebenbürgischer Baumstriezel wird da beworben! Der Laden führt den ungarisch klingenden Namen für Baumstriezel, die es in Ungarn ja auch gibt: „Kürtös Kalacs“, der Inhaber stammt aus Tschechien. Aber wie auch immer, da drinnen werden kleine Baumstriezel am laufenden Band gebacken und die Leute stehen Schlange dafür.
https://de.wikipedia.org/wiki/Baumstriezel

Nach einer Weile haben wir genug gesehen und biegen in eine Seitenstraße ab, die zum großen überdachten städtischen Markt, dem Daiichi Makishi, führt. Dort gibt es in der großen Halle so ziemlich jeden Fisch zu kaufen, den man aus dem umliegenden Meer ziehen kann, und unzählige kleine und große Muscheln und Schnecken. Auch die Metzger haben hier einen Stand am anderen, hauptsächlich Schwein, alles sehr schön und kunstvoll aufgebaut. Mit Obst und Gemüse, Tee und Heilkräutern und vielem mehr kann man sich in der Halle und in den Läden um den Komplex herum eindecken. Wir finden in einer der angrenzenden Straßen ein Fischlokal mit ein paar einfachen Bänken davor und während wir die Tafel mit der Speisekarte und den Bildern darauf studieren, fragen uns zwei junge Männer auf Englisch, ob sie uns vielleicht helfen können. Ja, natürlich gerne! Wir sind dankbar für Empfehlungen und folgen ihrer Einladung, uns zu ihnen an den Tisch zu setzen. Der eine ist der Bruder des Besitzers, hat eine Schürze um und hilft mit im Laden aus, der andere komponiert und textet Lieder für Musiker und möchte demnächst gerne ein Jahr lang in Berlin verbringen, die Stadt sei so spannend, habe er gehört. Wir essen Fisch-Carpaccio (roh) und ausgebackenem Fisch und Gemüse und bekommen darüber hinaus einen Teller mit kleinen Meeres-Schnecken zum Probieren.


So gut gestärkt gehen wir zurück zur Hauptstraße, erst zum Zentrum für Kunsthandwerk. Traditionelle, kunstvoll gewebte oder bedruckte Stoffe für Kimonos aus Seide oder Baumwolle sind dort zu bewundern, Lackarbeiten mit Intarsien und die schwere irdene Keramik, die für Osaka so typisch ist.

Werbetafel beim Tourismusbüro
Mit dem Stadtbus fahren wir danach zum Museum der Präfektur Osaka. Das riesige Gebäude aus Beton mit oben abgerundeten Ecken sieht innen sehr viel heller und freundlicher aus. In einem Trakt ist eine große kulturgeschichtliche Sammlung ausgestellt, während der andere für die moderne Kunst reserviert ist, ausschließlich Arbeiten von Künstlern aus Okinawa. Wir sehen uns die Sonderausstellung mit schwarz-weiß-Fotografien von Okinawa der letzten Jahrzehnte an, jeder der vier ausgestellten Fotografen hat seine eigene künstlerische Handschrift. Wir bekommen einen kleinen Einblick in die Zeit vor der großen Modernisierungswelle, die auch diese Inseln erfasst hat.


Gegen Ende des Nachmittags sind unsere Augen müde und brennen, wir können gar nichts mehr aufnehmen. Mit dem Bus fahren wir zurück nach Yonabaru und setzen uns zum Abendessen in eine winzige Kneipe, wo es die besten Yakitori (Fleisch am Spieß) geben soll. Der junge Mann am Grill begrüßt uns und alle anderen Gäste mit einer Freude und Herzlichkeit, als würde er Freunde willkommen heißen. Sozusagen im Fenster des Ladens steht ein Holzkohlegrill, wo Hühnerleber, -herzen und -mägen gebraten werden, ebenso wie Schweinefleisch, auch Eier oder Tomaten mit Schinken umwickelt gibt es am Spieß. Wir bestellen Bier und eine Variation von allem und futtern uns Spießchen um Spießchen entlang, unter den begeisterten Blicken des Personals und der Gäste, die sich freuen, dass es uns so gut schmeckt.