
Seit mehr als zwei Wochen sind wir nun schon draußen im Prince William Sound. Es war eine lange Zeit im Hafen: seit Mitte September für die Muktuk und seit Mitte Februar für uns. Vor allem ich hatte mich so sehr an Cordova gewöhnt, die Freunde im Hafen, die tägliche Routine trotz der vielen Einschränkungen, so dass ich mir gar nicht mehr so recht vorstellen konnte weg zu fahren. Und schon gar nicht an einem Regentag.
Aber schon nach den ersten hundert Metern, als die Masten und Antennen der Boote im Hafen und die Häuser von Cordova hinter uns langsam im Nieselregen verschwammen und sich vor uns das Wasser weitete, in der Ferne sich die schneebedeckten Berge mit den schwarzen Wäldern auftürmten, da kam gleichzeitig mit der Erinnerung an die Buchtentage des vergangenen Jahres eine unerwartete Euphorie auf. Ich hatte tatsächlich vergessen, wie schön es draußen sein kann!

Vier Stunden später hatten wir unsere erste Bucht, die Sheep Bay, erreicht. Unzählige Otter ließen sich mit der Strömung treiben, hoben neugierig den Kopf, sobald sie unseren Motor hörten, schwammen ein Stück näher, um dann mit einer schnellen Drehung unter Wasser zu verschwinden, bevor ich sie fotografieren konnte. Zwei Weißkopfadler flogen von Tannenspitze zu Tannenspitze und der große Wasserfall in der Bucht rauschte so laut, dass er das Motorengeräusch übertönte und überall an den Steilhängen stürzten, gespeist vom Schmelzwasser, größere und kleinere Bäche herunter.

Die ersten Tage verbrachten wir im Wesentlichen damit, zu lesen, zu kochen, den Regen und die Landschaft zu betrachten – das Aufregendste war eine donnernde Schneelawine hoch oben am Berg, die Steine und Strauchwerk mit sich riss. Internet gab es keines (zu hohe Berge ringsherum). Die Ruhe und Einsamkeit der Bucht tat uns gut.
Nach ein paar Tagen kam die Sonne heraus, ich hatte keine Ausrede mehr, nicht an Land zu gehen. Mit Bärenspray, Tröte und Gewehr stiefelten wir los und anfangs war mir schon noch ein bisschen mulmig zu Mute – auch noch, als wir den Berg hoch gingen auf der Suche nach dem Wanderweg zum See. Der Weg war nicht ausgezeichnet, also bewegten wir uns auf den Wildpfaden durch den Wald – Pfade, die die Rehe und Bären im Laufe der Zeit ausgetreten hatten. Doch von Bären waren noch keine Spuren zu sehen, nur die Losungen der Rehe und die Abdrucke ihrer Hufe in den verbliebenen Schneefeldern. Die ersten Blaubeersträucher blühen schon an besonders geschützten Stellen mit rosa oder weißen Blütenkelchen, und leuchtend kräftige hellgelbe, fast schon neonfarbene, Pflanzen wachsen aus dem Moos oder dem Schnee hervor, von Weitem sehen sie aus wie Pilze und sind wohl eine Delikatesse für die Rehe.





Auf Montague Island fanden wir einen Strand, wo wir an einem Abend grillten, anderntags lange Spaziergänge unternahmen und wo Andreas noch mal gutes Feuerholz sägte. In der Lagune konnten wir die ersten Zugvögel beobachten, sie waren nicht zu überhören: die Gänse zogen paarweise laut rufend übers Wasser.




Unterwegs von einer Bucht zur anderen hielten wir immer mal wieder an, um an einem Unterseehügel zu angeln – der erste Rockfisch der Saison ging gleich am ersten Tag an den Haken zusammen mit einem kleinen vorwitzigen Fischchen und eine Woche später biss sogar ein schöner mittelgroßer Heilbutt an! Jedes Mal ein Fest für die Bordküche!

Am Tag vor der Abfahrt aus Cordova hatten wir von der Werft im Nachbarort Valdez die schriftliche Zusage bekommen, dass wir die Muktuk dort aus dem Wasser heben können. Die Zusage war allerdings mit der Auflage verbunden, vorher mindestens zwei Wochen lang in Quarantäne vor Anker zu liegen. Außerdem sollten wir möglichst gut mit Vorräten ausgestattet sein, denn es sei nicht klar, wie frei wir uns in Valdez außerhalb der Werft bewegen dürften.

Der „travel ban“, das Verbot von Ort zu Ort zu reisen, wird also sehr pragmatisch ausgelegt. Ähnlich wie sich auch der wirtschaftliche Druck auf viele Entscheidungen ausgewirkt hat: die Fischerboote dürfen fischen, die Fischfabriken können den Fisch annehmen. Vorausgesetzt wird, dass jeder Betrieb ein Quarantäne- und Sicherheitskonzept vorlegt, das im Einzelnen von den Behörden genehmigt werden muss. Im Falle der Fischerboote heißt das, jedes einzelne braucht ein eigenes Konzept, da die Fischer als Selbständige mit Crew arbeiten.
Mitte Mai wird die Lachssaison eröffnet, die ersten Lachse, die zum Copper River Delta zurück schwimmen, gelten als ausgesprochene Delikatesse. Die Fischerboote richten momentan ihre Boote und Netze dafür her, viele von ihnen kommen für die Saison aus dem Süden und müssen zwei Wochen Quarantäne einhalten, wie auch die eingeflogenen Arbeiter, wobei ihnen die Zeit unterwegs wohl auch schon angerechnet wird. Cordova hat den Hafen inzwischen zur „hot zone“, also zu einem Brennpunkt erklärt, wo höhere Sicherheitsmaßnahmen als im Dorf selbst gelten.


Ein paar Sendemasten sind im Prince William Sound aufgestellt, so dass wir unterwegs und auch in einigen Buchten Internet haben. So können wir die Nachrichten einigermaßen verfolgen und uns über die neuesten Entwicklungen in der Pandemie informieren. Alaska hat bisher 378 getestete Fälle an Erkrankungen, davon 10 Tote, und in Anchorage werden ab Montag die Ausgangsbeschränkungen gelockert, Kinos, Restaurants, Fitnessstudios und mehr dürfen wieder öffnen. Aber nun ist auch in Cordova der erste Fall einer Covid-19 Ansteckung bekannt geworden.
Wir sind froh, dass wir momentan draußen in der Wildnis sein können. In Quarantäne oder im „lock down“, also wochenlang zu zweit alleine auf dem Boot zu leben, das kennen wir und es funktioniert sehr gut. Wir hatten ja auch ein paar Jahre Zeit, es zu üben. Wir müssen aber auch nicht gleichzeitig einen Vollzeitjob in Heimarbeit stemmen und nebenher die Schulaufgaben der Kinder beaufsichtigen. Ulrich Tukur, Schauspieler, Musiker und Schriftsteller schrieb kürzlich:
„Meine Gedanken sind oft bei denen, die mit dem Rücken an der Wand stehen und für die diese Zeit kein absurdes Theater ist, sondern existenziell bedrohliche Wirklichkeit. Ich hoffe inständig, dass sich der Vorhang bald über dieses seltsame Stück senkt und wir danach alle etwas bescheidener nach Hause gehen und darüber nachdenken, was da eigentlich gespielt wurde. Vielleicht fühlen wir dann endlich, wie zerbrechlich diese Welt ist und wie schützenswert. Wissen tun wir es längst.“ (Aus: DIE ZEIT Nr. 19, 29.04.2020)









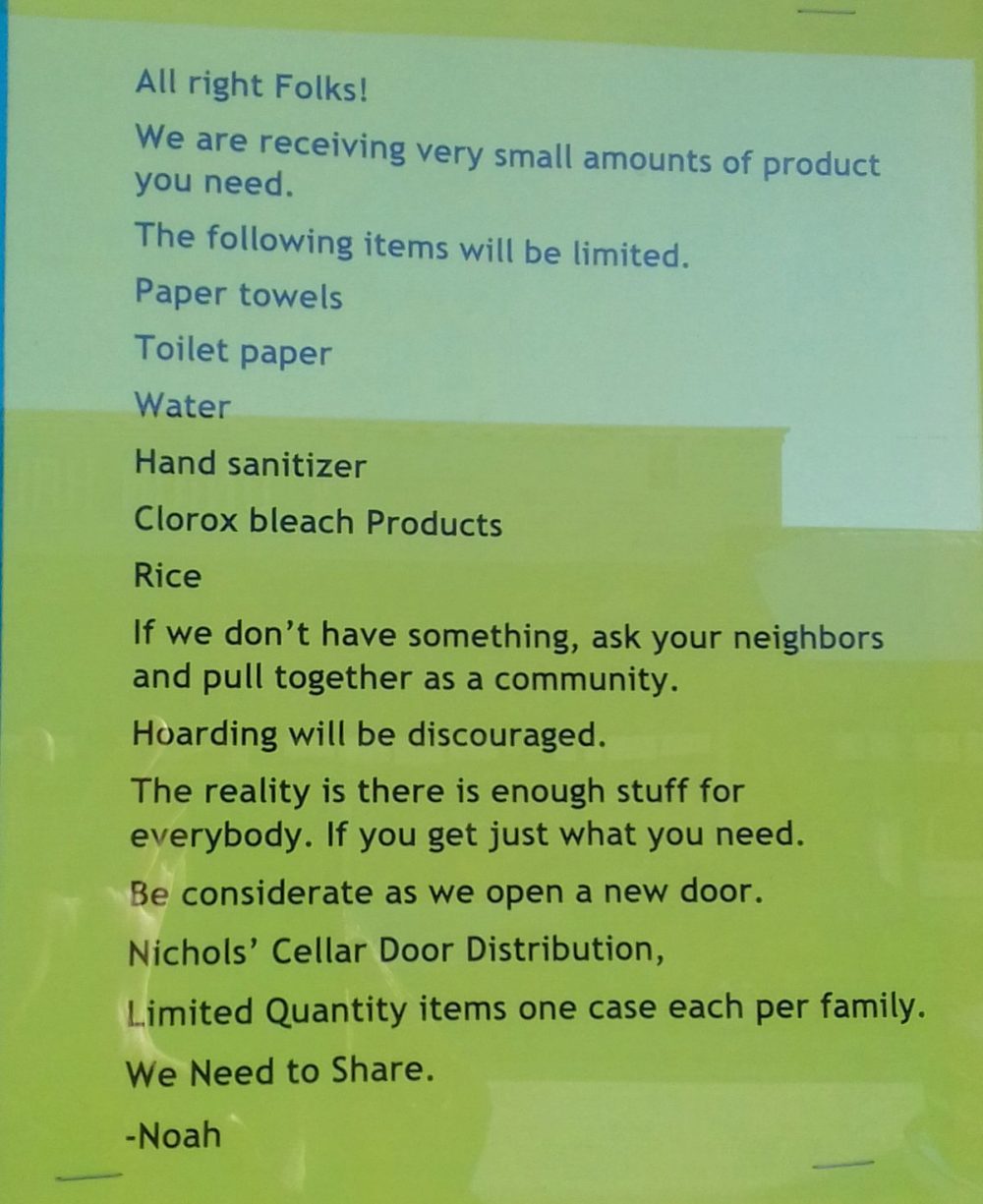


















































































 Beim Angeln am Fluss: Forellen und Saiblinge
Beim Angeln am Fluss: Forellen und Saiblinge



 Sooo groooß sind wir, wenn der Bär kommt!
Sooo groooß sind wir, wenn der Bär kommt!







