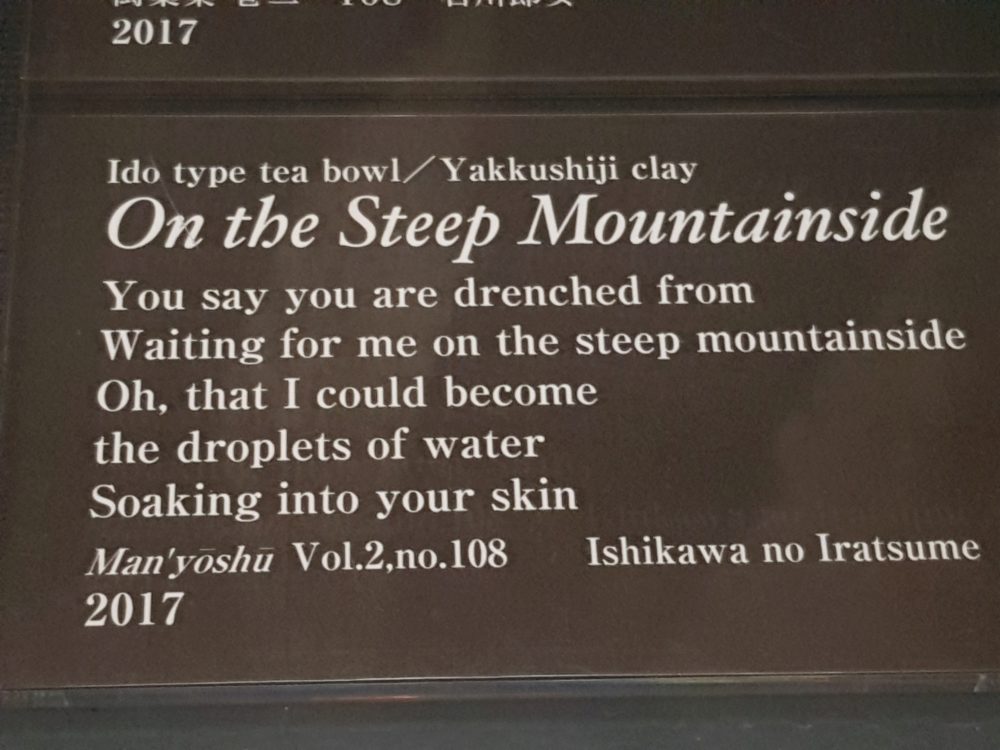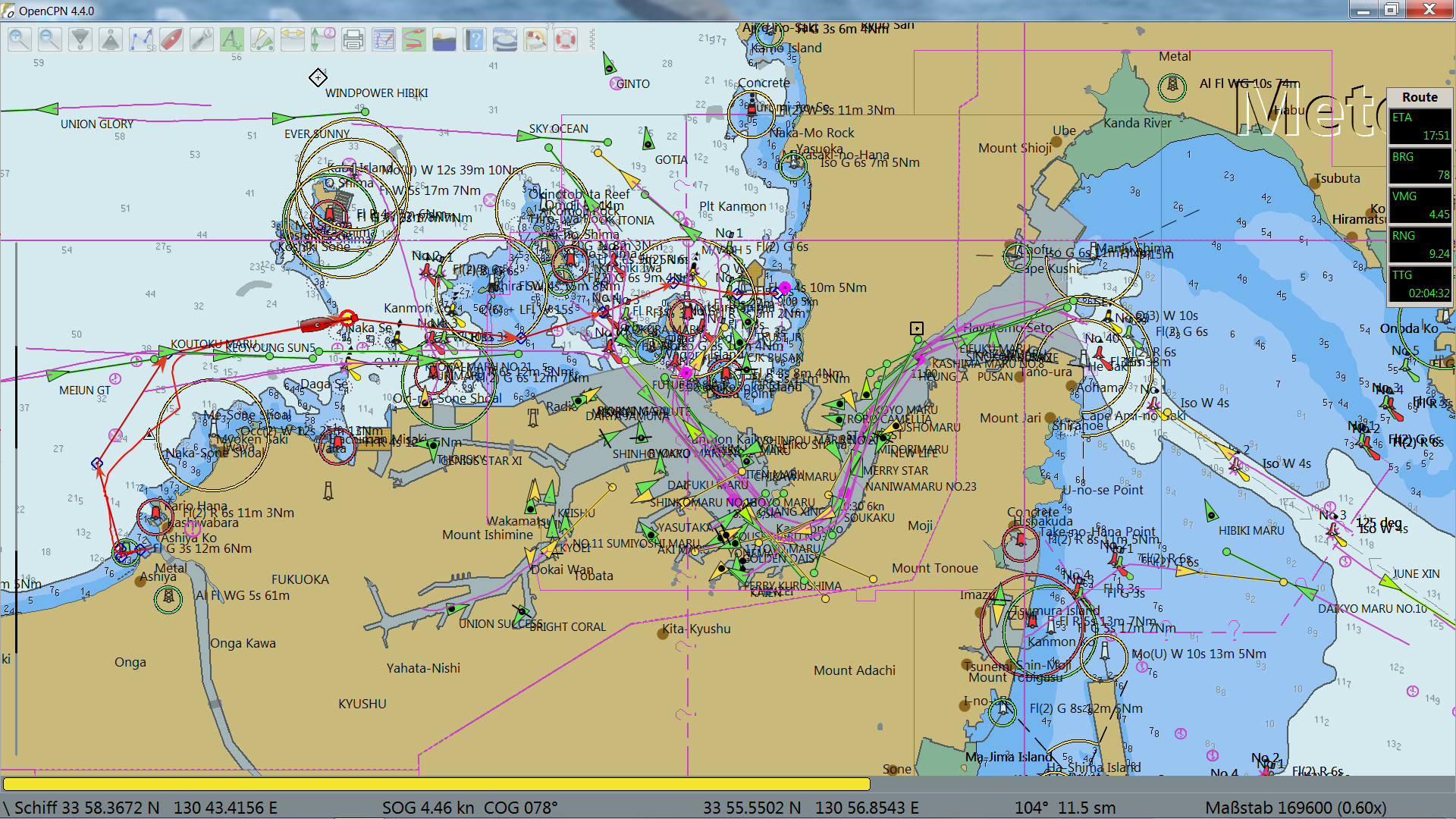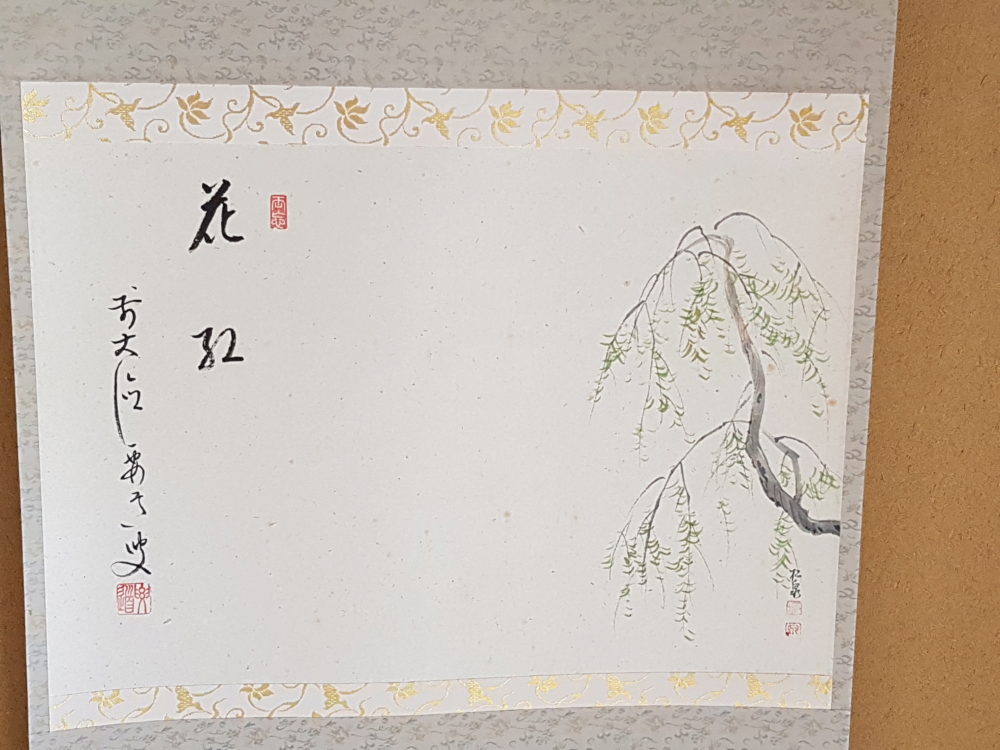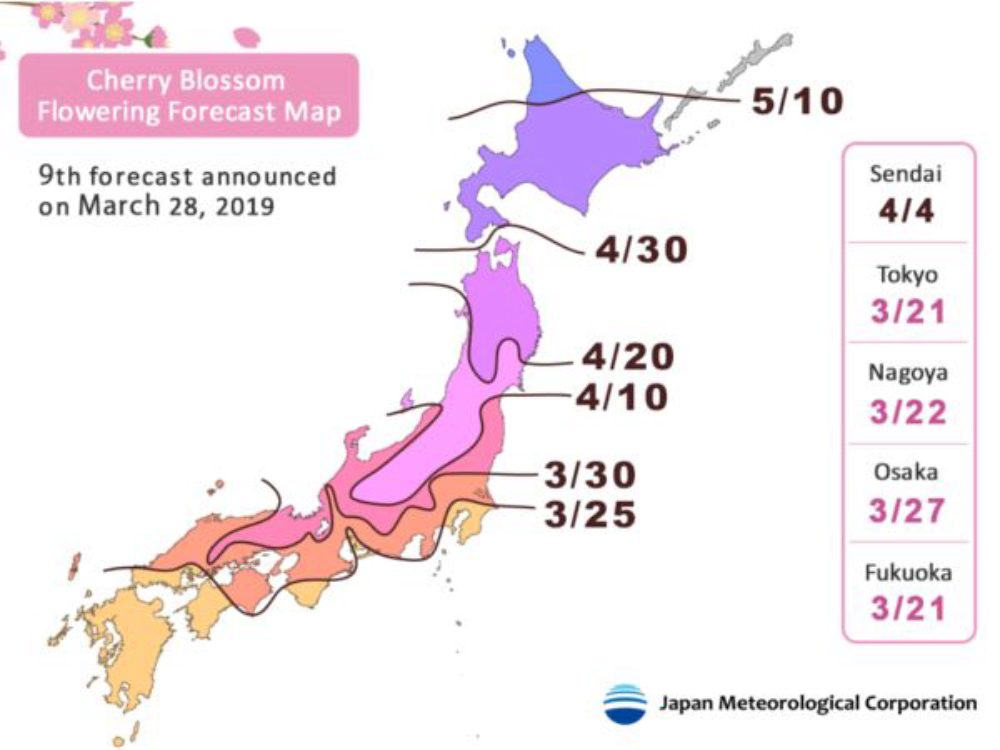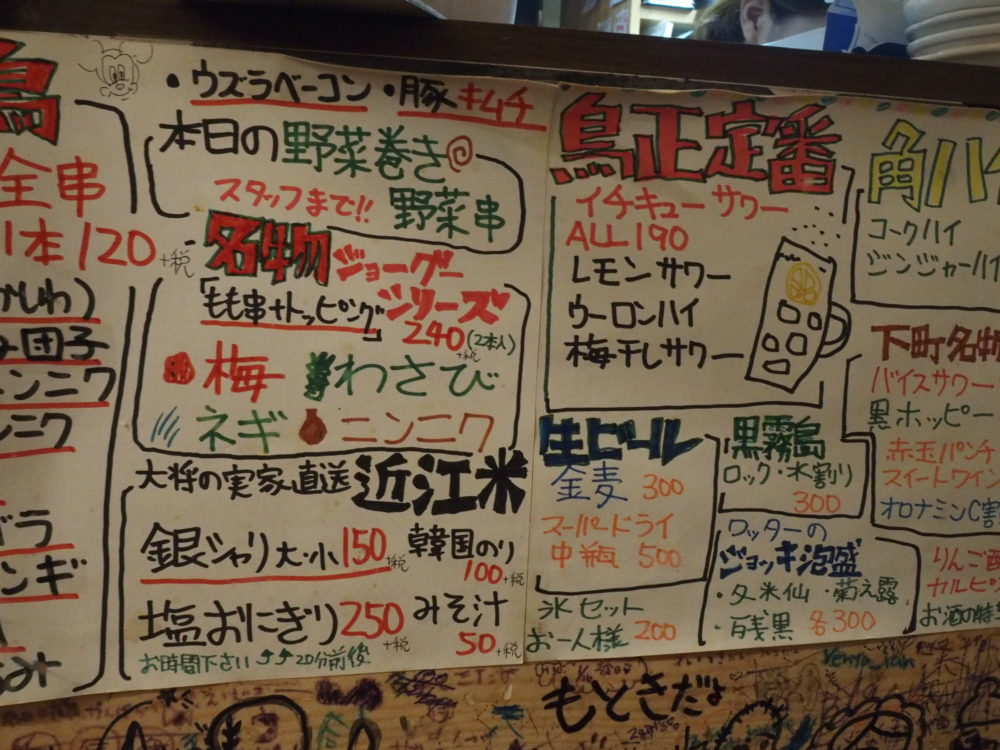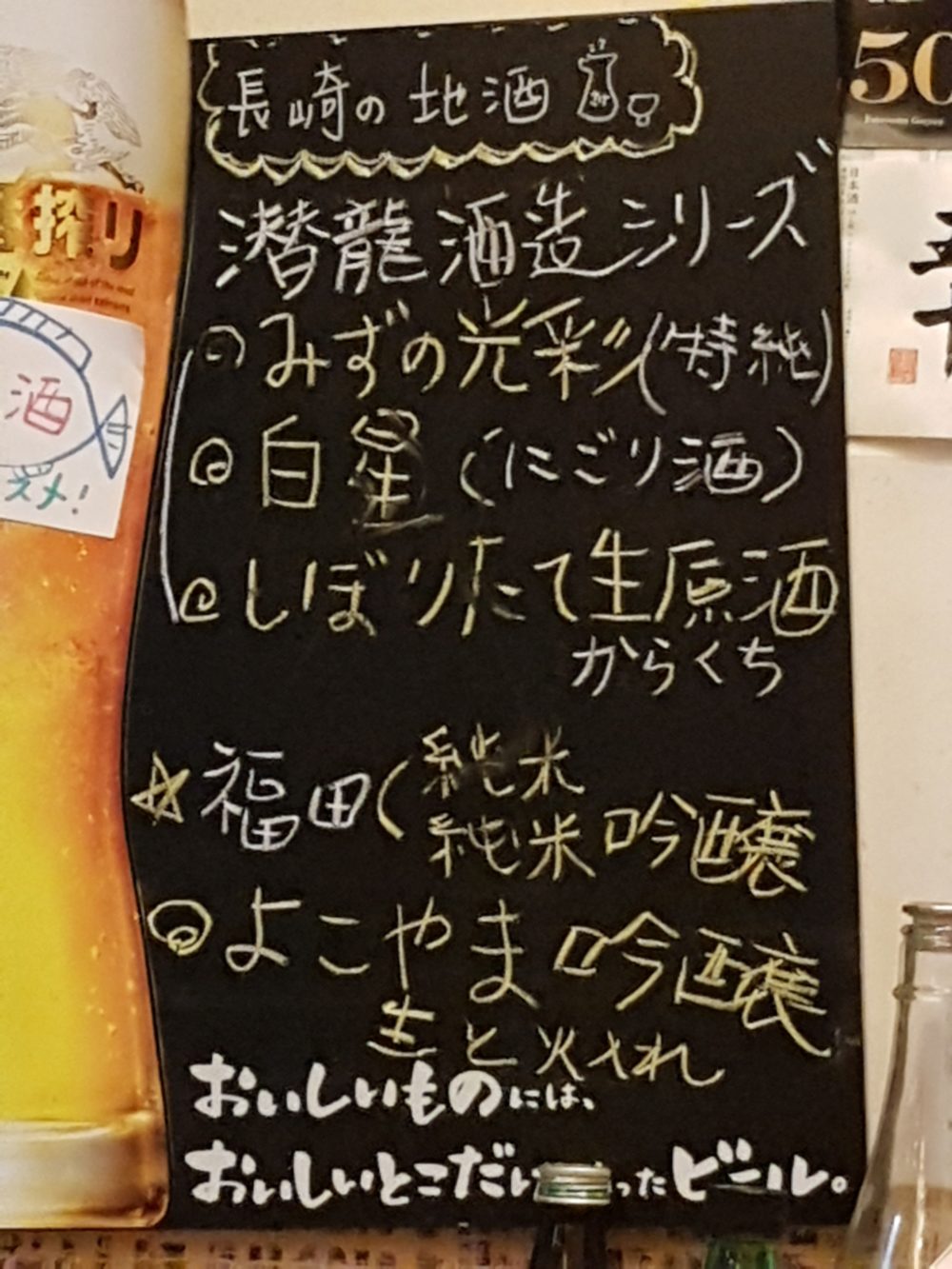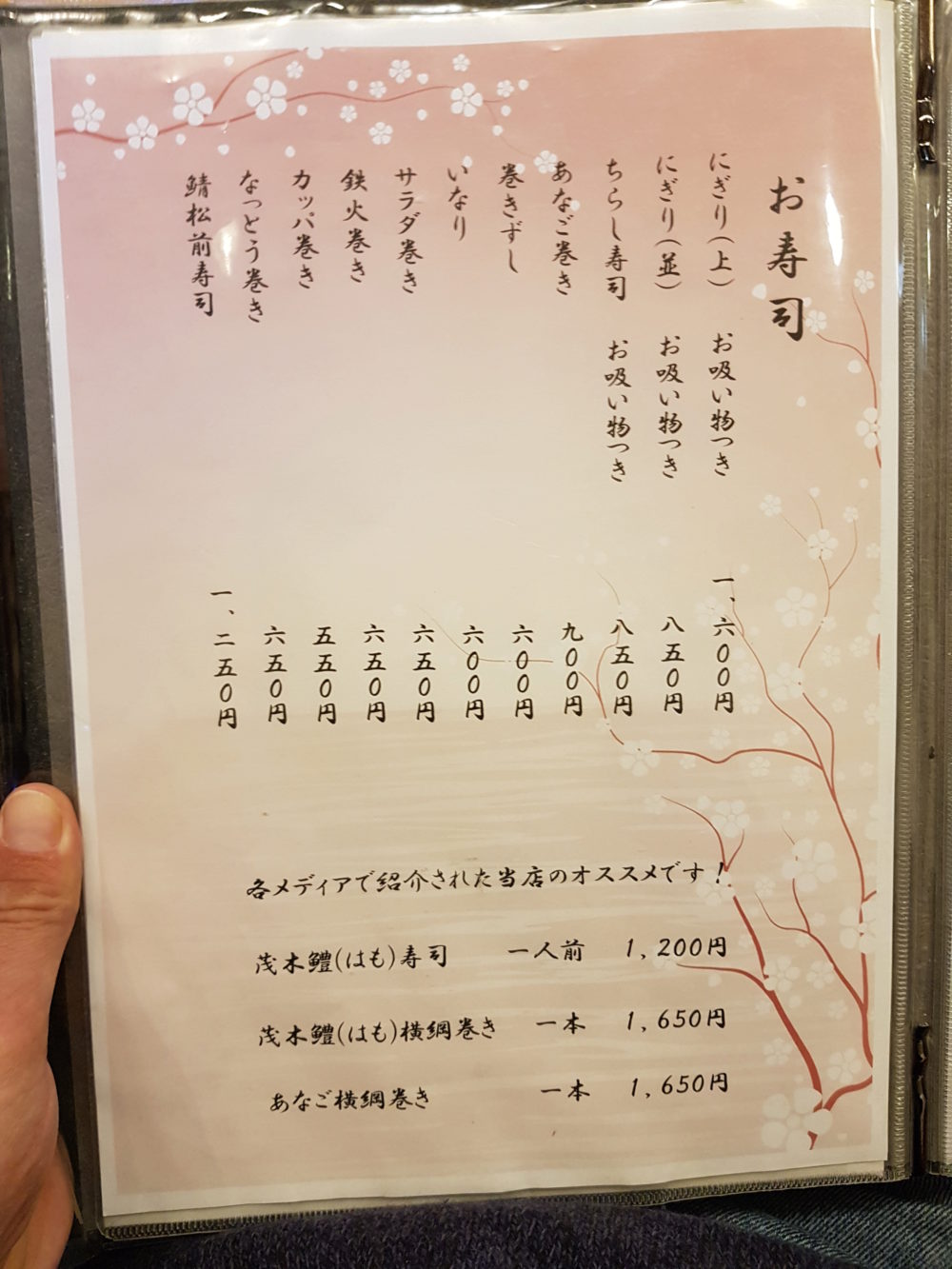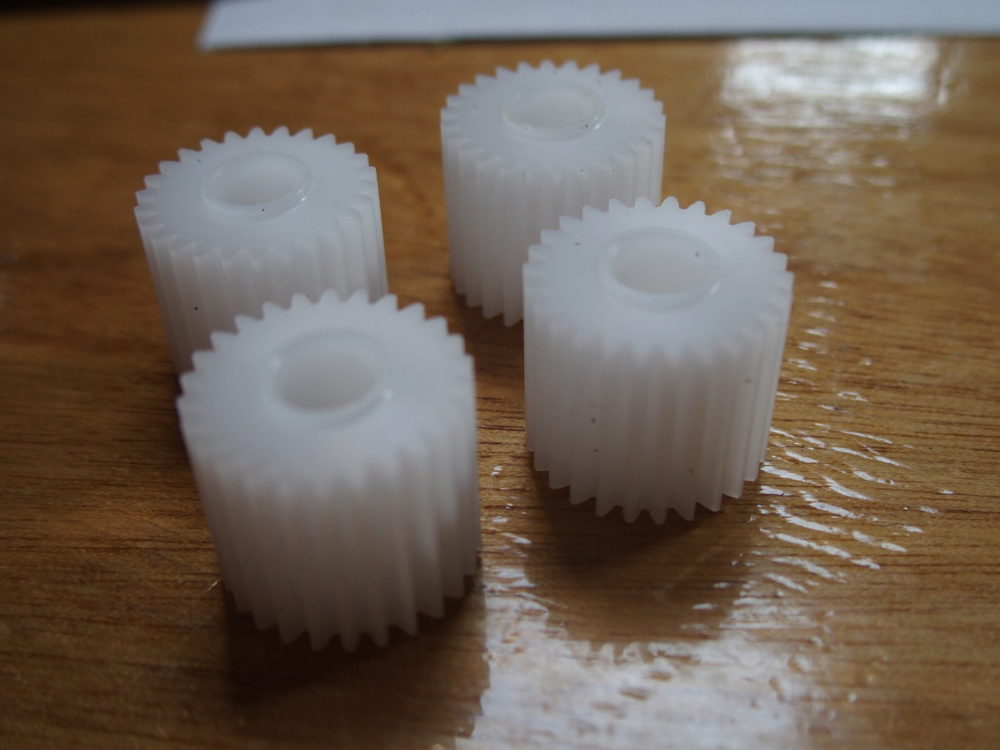In einem Reisebericht aus Japan darf natürlich ein Artikel über die Leidenschaft der Japaner für Toiletten nicht fehlen. Nach den oft rudimentären Aborten der Tropen kommt uns unsere Bordtoilette auf der Muktuk schon sehr komfortabel vor, immerhin sauber und mit (Salz-) Wasserspülung. Während unserer Deutschlandaufenthalte genießen wir den nochmals größeren Komfort, ohne Ventile auf- und zuzuschrauben, ohne 20 Pumpenschläge, einfach aufs Knöpfchen drücken zu können. Aber im Vergleich zu Japan ist die deutsche Toilettenkultur geradezu mittelalterlich.
Das fängt schon damit an, dass es für die Toilette eigene Pantoffeln gibt, die nur dort getragen werden, denn Toiletten sind potenziell schmutzig und man will das nicht im restlichen Haus verteilen. Während man beim Betreten eines Hauses die Schuhe auszieht und entweder in Socken oder in bereitgestellten Hausschuhen weiterläuft, wechselt man an der Schwelle zur Toilette nochmals das Schuhwerk.
Weiter geht es damit, dass einen nach dem Schließen der Tür die Toilette damit begrüßt, dass der Deckel der Klobrille motorgetrieben nach oben klappt (wohl irgendwie mit einem Kontakt am Türschloss gekoppelt). Setzt man sich auf die natürlich körperwarm beheizte Brille, ertönt das Geräusch eines Wasserfalls oder Bächleins, um eventuell peinliche eigene Geräusche zu übertönen. Die Lautstärke ist natürlich einstellbar. Die edleren Modellen können dazu noch überdeckendes Parfum versprühen.

Nach Verrichtung putzt man sich nicht etwa schnöde mit Papier, sondern benutzt verschiedene ausfahrbare Wasserdüsen zur Reinigung. Die Stärke des Wasserstrahls ist steuerbar, die genaue Zielerfassung regelt man durch die eigene Sitzposition. Am Ende (und wenn man den Knopf zum Ausschalten der Wasserspiele gefunden hat) muss man sich mit dem Papier nur noch abtrocknen. Es sei denn, man bevorzugt den eingebauten Föhn.
A propos Knopf: wo deutsche Toiletten einfachste Ein-Knopf-Bedienung aufweisen (oder zwei, wenn es einen Wassersparmodus gibt), ist die Bedienungstafel einer japanischen Toilette so komplex, dass oft ein Schaltpult an der Wand angebracht ist. Natürlich ausschließlich auf Japanisch. Und wo muss man nochmal draufdrücken, um zu spülen?

Findet man diesen Knopf, klappt dezent vorher der Deckel wieder zu, und nach Abschluss des Spülvorgangs zur Kontrolle wieder auf. Und natürlich ist da noch die Innenbeleuchtung der Schüssel zu erwähnen. Verlässt man den Raum, klappt die Toilette höflich wieder zu und desinfiziert sich für den nächsten Besucher.
Und bitte, bitte: nicht vergessen, die Pantoffeln auszuziehen. Ein schlimmerer Fauxpas wäre kaum möglich.