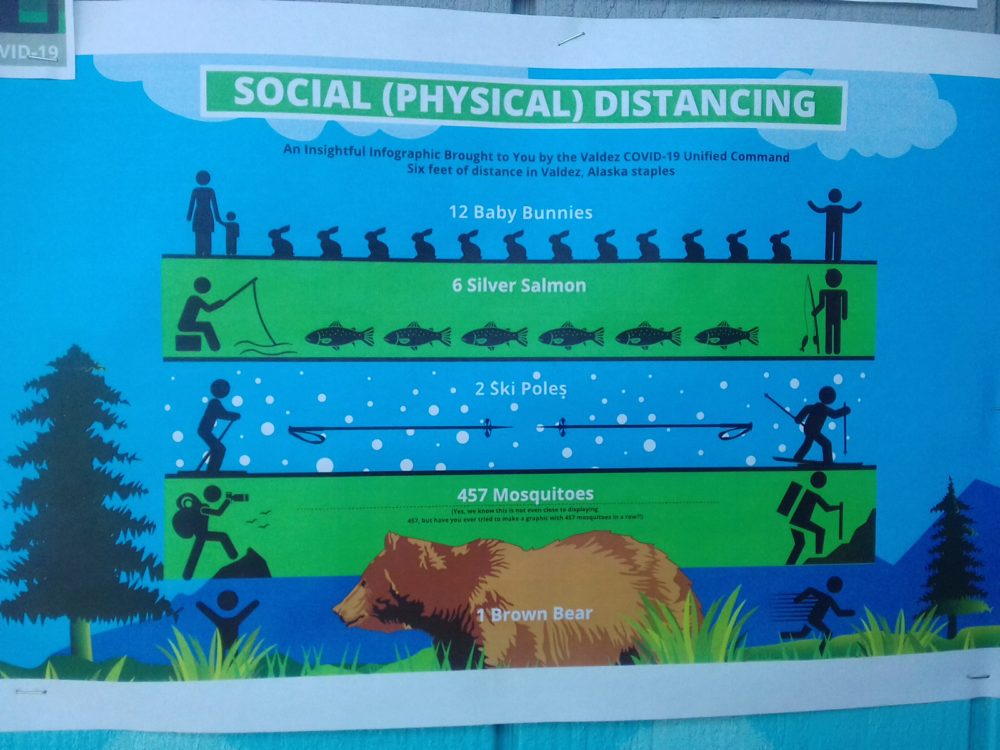Keine Sorge, wir machen nicht auf Titanic, wir sind nur zum Columbia Gletscher gefahren. Das heißt: ganz haben wir es nicht geschafft, denn das Eis wurde – je näher wir der Abbruchkante kamen – immer dichter, so dass wir am Ende nur noch im Schritttempo vorankamen. Dazu kommt eine weitere navigatorischer Herausforderung: Das Gletscherbett ist größtenteils rund 300 Meter tief, aber die ehemalige Endmoräne des Gletschers, die gut zehn Meilen vor der Gletscherkante liegt, ist überwiegend nur einige Meter unter Wasser. Da die Eisbrocken meist tiefer ins Wasser ragen, bleiben sie dort hängen und versperren die Durchfahrt. Es gibt aber eine Lücke in der Endmoräne, die ca. 20 Meter Wassertiefe bietet. Bei Ebbe drückt es die Eisbrocken aus dieser Lücke heraus, so dass auch diese Einfahrt verstopft ist. Nur während das Wasser steigt, also in Richtung Gletscher fließt, wird die Einfahrt vom Eis freigespült. Man muss es also während dieser Zeit rein, bis zum Gletscher hin und wieder heraus schaffen.


Um unseren frisch gestrichenen Lack zu schonen und weil es eben einfach zu lange gedauert hätte, mussten wir also irgendwann umkehren. Macht aber nichts, denn wir haben viele wunderschöne Eisberge gesehen und ein gutes Gefühl für die Navigation im Eis bekommen. Die meisten Eisbrocken, allesamt Abbruchstücke der bis zum Wasser reichenden Gletscherkante, sind relativ klein (maximal ein paar Meter groß), aber einige sind doch erheblich größer als unser Boot. Und eine solche Vielfalt: rein weiße oder tiefblaue, die Oberfläche sieht mal wie Schnee aus (wenn sie von der Sonnenwärme schon etwas angetaut sind), mal ganz glasig klar (wenn sie sich vor kurzem gedreht haben, so dass die ehemalige Unterwasserseite nach oben zeigt). Manche tragen noch Felsbrocken mit sich herum. Manche dienen Vögeln als Sitzplatz. Wir können uns nicht sattsehen.




Da wir mit unseren Freunden Catherine und Bruno von der französischen Jacht „Nosy Bé“ unterwegs sind, können wir schöne Fotos voneinander machen. Weil das Wetter so gut ist und wir kaum Wind haben, machen wir unsere Boote aneinander fest, treiben gemeinsam im Eis und veranstalten ein gemütliches Picknick am Vordeck. Allerdings driften wir doch noch mit ca. einem Knoten Fahrt durch die Eisfläche, so dass wir immer mal wieder ein paar Eisbrocken vertreiben müssen, die sich zwischen die beiden Rümpfe schieben und dort feststecken wollen.





Wir haben für diesen Ausflug optimale Bedingungen – gute Sicht, kaum Wind, keine See. Dennoch erfordert die Navigation im Eis Konzentration beim Rudergehen, denn viel Zickzack ist nötig, um den größeren Brocken auszuweichen, und auch die Geschwindigkeit muss immer wieder der Eisdichte angepasst werden. Unser Respekt vor der Durchquerung der Nordwestpassage, wo so etwas über Wochen hinweg nötig ist, ist jedenfalls noch einmal ein gutes Stück gewachsen.