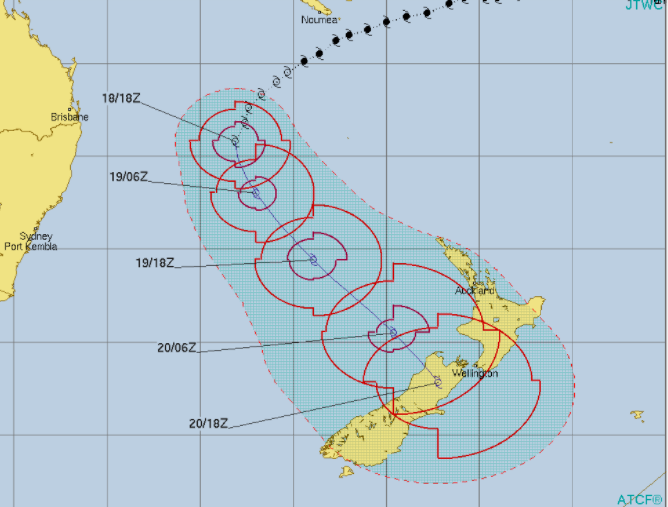Nach drei Wochen zivilisationsfreiem Segeln in den Sounds wurde der Kühlschrank langsam leer. Kein Fleisch mehr, kein Salat, die letzte Möhre gegessen, die letzte Tomate verschimmelt über Bord. Nein, wir waren nicht am Verhungern, Konserven gabs noch jede Menge, aber ein bisschen was Frisches wär‘ schon schön…

Im Revierführer, dessen neueste Ausgabe allerdings auch schon fünf Jahre her ist, heißt es über die kleine Siedlung Bulwer: das Guest House kann Fleisch und Eier besorgen, und in der nächsten Bucht gibt es einen kleinen Laden. Prima, denken wir uns.
Ein älterer Fischer, den wir am Anleger treffen, weiß nichts von derlei Einkaufsmöglichkeiten, aber wir sollen mal beim Haus oberhalb fragen. Zwischen den Häusern weiden Schafe, vor besagtem Haus liegen gemütlich zwei große Schweine herum. Wir rufen, werden durchs Gartentor gebeten.

Nach den üblichen Fragen woher und wohin dann die Info: nein, das Guest House hat zu, und der Laden hat schon vor Jahren dicht gemacht. Einkaufen – nur in der Stadt (gemeint ist Havelock, sechzig Kilometer weit weg).
Aber wie das so geht in Neuseeland: was bräuchten wir denn? Na ja, ein paar Eier, ein bisschen was Grünes, aber wir wollen natürlich nicht ihren Kühlschrank leerräumen… Nein nein, kein Problem, sie würde uns nur anbieten, was sie entbehren kann. Dankbar bekommen wir ein paar Eier, Gemüse, etwas Obst – ob wir sonst noch etwas brauchen? Na ja, drucksen wir, nach drei Wochen Fisch und Muscheln… wenn sie irgendwas mit Fleisch übrig hätten? Klar, wir bekommen eine Tüte voll eingefrorener Lammkoteletts, selbst geschossen und gesägt. Wir einigen uns auf den Preis und machen uns froh auf den Weg zurück zum Boot. Am Abend gibt es köstliches gebratenes Lamm, superlecker.

Am nächsten Tag gehen wir nochmal an Land, bedanken uns bei der netten Familie mit ein paar Lebkuchen. Am Anleger kommt uns eine andere Frau entgegen: sie waren diese Woche hier im Urlaub und fahren morgen zurück nach Christchurch, ob wir nicht ihre Restbestände an Lebensmitteln brauchen können? Ein großer Karton wartet auf uns vor ihrem Haus.

Das Leben in diesen abgelegenen Siedlungen scheint nicht viel anders als das Leben am Boot zu sein. Man ist Selbstversorger, autark was Wasser und Strom angeht, und man hilft einander ganz selbstverständlich. Großartig, dieses Neuseeland.