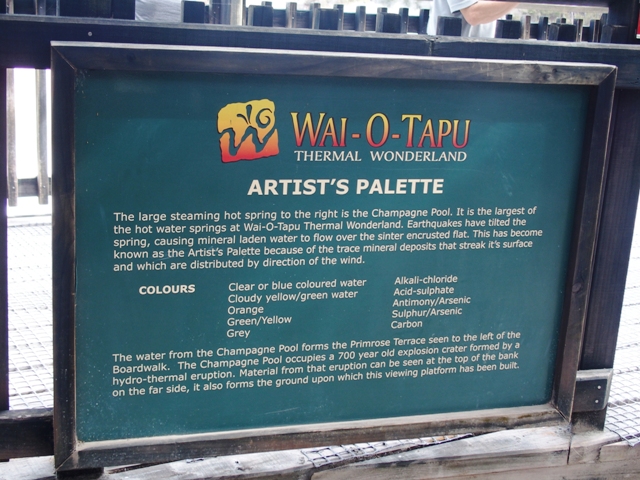Es ist schon halb sieben Uhr abends und die Sonne steht immer noch hoch am Himmel. Der Blick auf den Kalender zeigt Anfang Dezember, ganz ungewohnt für uns, dass die Tage immer noch ein bisschen länger werden. Wir haben nun schon seit mehr als einer Woche ein festsitzendes Hoch über Neuseeland, das uns einen sonnigen Tag nach dem anderen beschert. Die ersten Tage haben wir noch brav Rost geklopft und das Deck gestrichen, nun machen wir eine Pause und es fühlt sich fast so an wie Urlaub. Von Bucht zu Bucht tuckern, mal hier, mal da länger bleiben, Fische fangen, Delfinen beim Jagen zuschauen, Wandern gehen.


Die Insel Great Barrier liegt gar nicht so weit von Auckland entfernt und doch ist man hier in einer ganz anderen Welt, so abgeschieden fühlt es sich an, hier zu leben. Alles ist langsamer, stiller, ruhiger. Früher, ohne die modernen Kommunikationsmittel, und ohne die Anbindung mit Flugzeug und Schnellfähren, war das Leben auf der Insel hart und entbehrungsreich.
So ziemlich alles hat es hier schon gegeben seit der Ankunft der europäischen Einwanderer: Gold- und Silbergräber in kleinen Minen, ein großes Sägewerk, das nicht nur den kompletten Kauri-Bestand der Insel verarbeitet hat, bis nichts mehr da war, sondern auch Holz vom Festland zerkleinerte. Und zuletzt gab es noch eine Walstation, wo bis vor ein paar Jahrzehnten Wale aus dem Meer heran gebracht und verarbeitet wurden.
Ende der 60er Jahre operierte ein Piratensender im Hauraki Golf: ein Radiosender ohne amtliche Genehmigung ging auf Sendung außerhalb der 5-Meilen-Zone. Ein paar Mal gerieten die Radiomacher bei schlechtem Wetter in Seenot und das erste Boot strandete an den Felsen im Südwesten der Insel. Die Insulaner zeigten sich solidarisch und halfen ihnen, wo sie nur konnten, beim Crewwechsel, Proviant laden, sie waren schon immer ein eigenes Völkchen.
Inzwischen wird Great Barrier Island von Auckland aus mit verwaltet und in vielen Bereichen finanziell und personell unterstützt, sei es beim Straßenbau, der Schule oder dem Krankenhaus, was die meisten Bewohner dankbar annehmen. Auch die Naturschutzbehörde DOC (Department of Conservation) ist hier aktiv und kauft immer weiter Land auf. Insulaner werden bei der Instandhaltung der gut ausgebauten Wanderwege beschäftigt, Kauri Bäume werden neu gepflanzt und brauchen einen besonderen Schutz, der nachhaltige Tourismus wird damit gefördert. Die Insel ist „pest-free“, also ohne Possum, Ratten und sonstige Nagetiere und möchte das gerne bleiben. Ein gutes Zeichen für einen sich erholenden Busch und Wald sind die vielen Pohutukawa Bäume, die jetzt langsam ihre rote Blütenpracht entfalten. Possums vergreifen sich nicht nur an Bodenbrütern, sie haben es auch auf junge Bäume abgesehen und knabbern wohl wirklich alle Triebe ab. Die Vögel hört man laut singen und auf unseren Wanderungen können wir sie nicht nur hören sondern auch ein paar der selteneren Exemplare sehen.

Pohutukawa Baum


Auf dem Weg zum Mount Hobson geht es über viele Brücken…

… und vor dem Gipfel hunderte von Treppen hinauf


Freitag abends ist der Boat Club in Port Fitzroy ein Treffpunkt für die Segler und Fischer in der Gegend, wir unterhalten uns mit einem Seglerpaar, das schon wochenlang hier mit seinem Boot ankert und diese Ecke am liebsten gar nicht mehr verlassen möchte.

Abendstimmung in Port Fitzroy
Auf der kleinen Insel Rangiahua, die zu Great Barrier gehört, ankern wir neben einem schönen alten Fischerboot und binden unser Dinghi an einem gut gebauten Steg fest. An Land sehen wir einen Mann in seinem großen Garten arbeiten. Wir fragen ihn, ob wir ein bisschen über die Insel spazieren gehen dürfen. Ja, natürlich gerne. Er ist einer der letzten Hummerfischer und lebt mit seiner Frau und einer Tochter hier, die anderen vier Kinder arbeiten in Australien und Auckland, und kommen mit den Enkeln nur noch in den Ferien zu Besuch. Als er hört, dass unser Hummerkorb immer leer war, meinte er: „Ach, hätte ich das gewusst, dann hätte ich die große Languste von gestern Abend in euren Korb gepackt, statt sie zurück ins Meer zu werfen.“ Und er fragt kenntnisreich, wie es nun in Deutschland mit der Regierungsbildung weiter geht. (Das passiert und immer wieder, dass wir hier in Neuseeland über das politische Weltgeschehen von Europa und anderen Kontinenten diskutieren können. Dabei sind wir jedes Mal beschämt, denn wir wussten bis vor einem Jahr fast bis gar nichts von den Ländern im Pazifischen Raum).

Blick vom Berg der Insel Rangiahua

Blühender Flachs
Im Dörfchen Whangaparapara treffen wir die neue Besitzerin der Great Barrier Lodge, in einer Woche kommen die ersten zahlenden Gäste, ein Café und Restaurant gibt es bei ihr und dazu noch einen kleinen Supermarkt. Die Handwerker hört man klopfen und viele Helfer wuseln herum und trotzdem nimmt sie sich Zeit für einen kleinen Plausch, erzählt, dass die mit ihrem Vater zurück auf die Insel gezogen ist, das Leben in Auckland war ihr einfach zu hektisch. Klaus, ein Deutscher, früher Ingenieur, dann Segler und jetzt Fischer, lebt nun schon seit etwa 30 Jahren in dieser Ecke von Neuseeland. Er erzählt von Zeiten, als es noch fast vierzig Fischerboote im Hafen gab, aber nun sind sie nur noch zu zweit. Aber nicht etwa, weil es weniger Fisch gäbe, meint er, sondern weil man einfach nicht mehr davon leben könne, nachdem die Preise für den Fisch in den Keller gegangen sind, nur noch ein Drittel des früheren Preises könnte man heute erwarten.
Ein anderer Bewohner, der fast jeden Tag mit der Angel am Hafen steht, unterhält sich auch länger mit uns. Sie mögen hier die Abgeschiedenheit und als im Ort Whangaparapara zwischenzeitlich um die 33 Einwohner ansässig waren, überlegten sie, ob es nun nötig sei an der einen und einzigen Kreuzung eine Ampel zu installieren…
Nun zieht es einerseits ruhebedürftige Großstädter hierher und viele junge Leute, die auf der Insel keine Arbeit finden, gehen weg. Freiwillig die einen, und weil es nicht anders geht, die anderen.
Wir haben uns von der Ruhe der Insel anstecken lassen und wollen am liebsten gar nicht mehr weg von dieser schönen Ecke mit den vielen freundlichen Menschen.



Manuka in voller Blüte